Der Übersetzer und Essayist Hans Jürgen Balmes hat eine Biographie des Rheins verfasst. In dieser nimmt er den Leser mit auf sein Faltboot und erzählt ihm die ganze, unendliche Geschichte des Stroms – vor und mit dem Menschen.

Wie alt ist der Rhein? Zwanzigtausend Jahre? Zwanzig Millionen Jahre? Zweihundert Millionen Jahre? Kommt drauf an, welchen Rhein man meint. Der Rhein, den wir von der Landkarte kennen und an den wir Ausflüge machen, in den Rheingau oder zum Drachenfels, ist ein relativ junger Fluss, der gegen Ende der letzten Eiszeit entstand, vor gut zehntausend Jahren. Aber seine Quellen reichen in viel ältere Zeiten: Der erste Rheinfluss entsprang vor, sagen wir, Jahrmillionen in der Gegend des Siebengebirges, später im Rheinischen Schiefergebirge, und arbeitete sich, unter Beihilfe anderer Zuflüsse, durch den Oberrheingraben gleichsam vor zu seinen heutigen Ursprüngen in den Schweizer Alpen.
Bei Bingen nahm der Rhein sein Ende und seinen Anfang
Schon deshalb ist es ein glücklicher Einfall, dass Hans Jürgen Balmes seine Rhein-Biografie nicht an der Quelle oder an der Mündung des Flusses, sondern in der Mitte, auf halber Höhe seines heutigen Laufes, beginnt, bei Bingen, wo der Rhein einst sein Ende und seinen Anfang nahm und heute in einer dramatischen Wendung nach Norden abbiegt. Da sieht der Leser auch gleich seinen Autor, auf einem der Steindämme im Fluss, am Rand der Fahrrinne liegend, bei einer seiner Lieblingsbeschäftigungen: wie er dem Fließen des Flusses zuhört, seinem Rauschen und Gluckern, das unterbrochen wird vom Mahlen der Schiffsschrauben und Rattern der Güterwaggons; wie er zwischen den Binger Kribben, den Steinwällen, die vom westlichen Ufer in den Fluss ragen, die sumpfige Vegetation mit ihren silbrig-grünen Weiden und Pappeln in Augenschein nimmt; wie er die Flussregenpfeifer und Möwen auf den Kiesbänken der Nahemündung beobachtet und wie er zu einer geologischen Zeitreise ansetzt, die von den fünfzig Millionen Jahre alten Fossilien der Grube Messel bei Darmstadt bis zur Giftmülldeponie, einer künstlichen Grube, dem „Slufter“, am Delta des Rheins bei Rotterdam reicht.
Ein Produkt des Menschenzeitalters
Anschauliche Betrachtung, „zarte Empirie“ im Sinne Goethes: das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken der Flusslandschaft, verbindet sich bei Balmes mit der Reflexion auf ihr evolutionäres Geworden-Sein, auf ihren kontinuierlichen Wandel, der keinen Stillstand kennt, und auf ihre künstliche, vom Menschen gebändigte Form. Denn das ist eines der Leitmotive dieser „Biografie“, die Erzählung, Reportage, Essay und Anekdotensammlung zugleich ist: dass der Rhein über riesige Zeiträume hinweg entstanden ist, aus dem Zusammenspiel der Elemente, dem „ewigen“ Kampf von Wasser, Felsen und Luft, und innerhalb von gerade einmal zweihundert Jahren, von der Quelle bis zur Mündung, zu einem Artefakt wurde, zu einer kanalisierten Wasserstraße, zu einem Produkt des Anthropozäns, also des Menschenzeitalters.
Eine Fischtreppe für Seeforellen
Schon der Vorderrhein mit der Ruinaulto-Schlucht, im Kanton Graubünden, wo der Autor auf der Suche nach den Flussuferläufern ist (Signalruf: ein helles „hidi-hidi-hidi“), gleicht einer Turbinenlandschaft: Der Rhein und seine Zuflüsse werden zur Stromgewinnung durch Röhren und Staubecken geschickt (die Seeforellen, die es im 19. Jahrhundert noch zu Tausenden gab, werden seit dem Jahr 2000 über eine Fischtreppe vom Bodensee an den Stauwehren vorbei zu ihren Laichgründen am oberen Alpenrhein geführt). Zwischen Basel und Mainz, im Oberrheingraben, begann die Arbeit an der Nutzbarmachung der Rheinlandschaft schon im Jahr 1817. Unter Anleitung des badischen Ingenieurs Johann Gottfried Tulla (1770 – 1828) wurde auf der einst größten Baustelle Europas der ausschweifend mäandrierende Rhein, eine an den Mississippi erinnernde Insellandschaft, peu à peu, von Süden nach Norden, begradigt und eingedämmt. Ein Jahrhundert-Projekt der Natureroberung.
Rückgang der industriellen Verschmutzung
Sein Vorteil: Der Oberrhein wurde schiffbar gemacht, die Menschen am Rhein gewannen Land zur Bewirtschaftung und mussten nicht mehr Angst haben vor Überschwemmungen und Sumpfkrankheiten wie der Malaria. Sein Nachteil: Die Hochwassergefahr verlagerte sich stromabwärts nach Norden, die Auenwälder trockneten aus, die Altrheinarme mit ihren Schilfflächen verschwanden und mit ihnen die Tiere und Pflanzen, die sie bewohnten. Ein weiterer wichtiger Nebeneffekt: Die wegen der Industrieabwässer so wichtigen Selbstreinigungskräfte des Rheins ließen mit seiner Kanalisierung nach. Erst die Giftunfälle der Sechziger- und Siebzigerjahre, so Hans Jürgen Balmes, führten dazu, dass überall Kläranlagen entlang dem Rhein gebaut wurden und die industrielle Verschmutzung zurückging.
So sauber wie lange nicht mehr
Heute ist der Rhein, trotz der Arzneien, Herbizide, Schwermetalle und (aus der Jauchedüngung stammenden) Stickstoffe, die er zur Mündung mit sich schleppt, so sauber wie lang nicht mehr. Der Autor beschreibt, wie es sich anfühlt, im Fluss zu schwimmen, bei Niederwalluf im Rheingau, wo er sich den Fischen und Vögeln näher fühlt und einen Schluck Wasser in den Mund nimmt und gleich wieder ausspuckt, „säuerlich wie Gerbstoffe im Leder, etwas chemisch“, anders als an den Quellen, wo er das „Aroma von im Handschuh geschmolzenem Schneeball“ schmeckt. Es gehört zu den Meriten dieser Rhein-Biografie, dass sie auf Konkretheit besteht, auf leiblich-sinnlicher Erfahrung. Sie gibt dem Leser das Gefühl, dabei zu sein, wenn es, nahe dem Kühkopf im Hessischen Ried, in Gummistiefeln durch die Sümpfe der Knoblochsaue geht, mit Blick auf die Haubentaucher, die hier ihr Balzrevier haben, oder mit dem Kajak durch die Strudel des Mittelrhein-Canyons, an Oberwesel und der Loreley vorbei.
Viel Fantasie erforderlich
Aber sie stellt auch hohe Anforderungen an die Einbildungskraft des Lesers (ein paar erklärende Schautafeln hätten nichts geschadet), etwa wenn daran erinnert wird, dass dort, wo heute der Rheingraben ist, sich vor Urzeiten eine riesige Schwemmebene ausdehnte, unterhalb derer sich der Rhein mit der „Geduld der Erosion“ sein Bett grub. Oder wenn das Rheinische Schiefergebirge als einstiger „Nachbar der Bretagne“ vorgestellt wird: Beide hätten zu einem Gebirgszug gehört, vor schlappen 340 Millionen Jahren, als unser Kontinent Europa entstand durch den Kontinentaldruck von Süden, aus Ur-Afrika, auf Ur-Europa, das „damals“ mit Ur-Amerika verbunden war. Zeugen dieser Vorvergangenheit stellen die Fossilien dar, die in der Schiefergrube bei Bundenbach im Hunsrück, 40 Kilometer westlich des Rheins, gefunden wurden. Sie zeigen Tiere und Pflanzen, Seelilien und Seesterne, die vor 400 Millionen Jahren auf den Meeresboden herabgesunken sind und vom Schiefer aufbewahrt wurden, als „unsere unendlich fernen Nachbarn“, wie Balmes so treffend sagt.
Erinnerung an die Sandoz-Katastrophe
Weniger treffend sind Formulierungen, die Begegnungen mit der lebendigen Natur einfangen. Angesichts eines Steinbocks, der im Quellgebiet des Rheins auf einer Felskanzel auftaucht, schnurrt die „Gegenwart zu unserem Starren zusammen“. Die Abend- und Nachtlandschaft vor einer Alpenhütte wird erlebt, „als würden die Hänge uns gegenüber eine neue Seite aufschlagen“. Von den Schwalben am Rhein heißt es, dass sie „uns in den unsichtbaren Kokon ihrer Flugkurven einspinnen“. Und zu William Turner, dem Maler des Mittelrheins, dem er mehrere, schöne Kapitel widmet, fällt dem Autor ein: „Turners Farben sind nicht das Fell der dargestellten Dinge, sie sind die atmende Haut des Sichtbaren.“
Mehr Raum um die Menschen
Auch hätte ein etwas sparsamerer Umgang mit Adjektiven dem Buch gutgetan. Die „kastanienbraunen Binsen im flaschengrünen Ufergras“, das „stille Wimmeln der Kaulquappen“, das „weiche Rieseln in den Wiesen“, der „schattige Tunnel aus flirrendem Grün“, das „auf und ab schaukelnde Schillern“ des Laubs – es ist alles ein bisschen zu viel. Trotzdem folgt der Leser dem Autor mit Lust, denn man merkt: Er schreibt mit Liebe und dem Willen zur Genauigkeit, etwa wenn er von der Flora am Mittelrhein oder der Rückkehr der Lachse und Maifische nach der Sandoz-Katastrophe 1986 erzählt. Oder wenn er den Leser mitnimmt auf Vogelexkursionen am Niederrhein, in einem der Altrheinarme bei Rees, zwanzig Kilometer vor der holländischen Grenze: Dann öffnet sich die Landschaft zum Horizont, es ist „mehr Raum um die Menschen“, und endlich tauchen auch die selten gewordenen Trauerseeschwalben auf, die hier ihr Sommerhabitat haben, neben dem Teichrohrsänger und dem Bitterling, einem Fisch, der in Symbiose mit der Teichmuschel lebt, in deren Kiemen die Weibchen ihre Eier ablegen.
Ein Förderband einwandernder Arten
Er ist längst in der Minderheit gegenüber den Arten, die als blinde Passagiere im Wassertank der Schiffe an den Rhein gekommen sind. Der Rhein, so Balmes, sei heute ein „Förderband einwandernder Arten“, die meisten kommen über den Hafen von Rotterdam, über das Mündungsgebiet des Rheins, da, wo sich einst, vor Achtzehntausendjahren Land ausbreitete, zwischen Friesland und Britannien, und heute technische Infrastrukturen dominieren: Riesige stählerne Sperrwerke, mehr als zweihundert Meter lang, schützen die Rotterdamer Metropolregion, ihr Hafengebiet Maasvlakte ist dreimal so groß ist wie der Frankfurter Flughafen. Die wichtigsten Betriebe: der Containerterminal, ein Knotenpunkt von Waren- und Datenströmen, das Kohle- und Biomassekraftwerk, das Logistikzentrum – und, hinter dem höchsten Damm im Rhein-Delta, der „Slufter“, ein künstlicher Krater, „der Aushub des Rotterdamer Hafens, das Geschiebe und Geröll, das nicht mehr in der Nordsee verklappt werden darf“, ein „Endlager“, wie Hans-Jürgen Balmes im Schlusskapitel schreibt, eine „gigantische Giftmüllhalde“, die darauf wartet, irgendwann einmal entsorgt zu werden, unter dem „Surren der Windräder“ – hoffentlich nicht zu spät.
Die Seeschwalben im benachbarten Naturschutzgebiet kümmert es naturgemäß nicht: Sie „falten ihre Schwingen auf, recken ihre Flügelspitzen und sind schon in der Luft“.
Von Christopher Schwarz

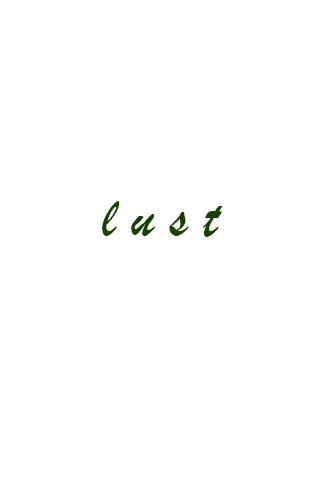



Fantastisches Buch!