Der Architekt und Stadtplaner Wolfgang Christ über den Niedergang der Fußgängerzone, das digitale Biedermeier, die Frage, was wir in der Stadtmitte eigentlich noch suchen – und was Deutschland von der Kleinstadt Hohenems im österreichischen Voralberg lernen kann.

Herr Christ, wir haben ein halbes Jahr nach dem Höhepunkt der Pandemie noch die trostlosen Bilder im Kopf: leere Einkaufsstraßen, leere Schaufenster, leere Restaurants und Cafés. Hat sich das Leben, nach Ihrem Eindruck, in den Innenstädten seither normalisiert?
Das hängt davon ab, wo man unterwegs ist. Wir wohnen in Heidelberg, einer Universitätsstadt, die wegen der hohen Dichte an Forschungseinrichtungen von wirtschaftlichen Schwankungen weniger stark betroffen ist als andere Städte. Hinzukommt der Tourismus, der mittlerweile wieder in Gang kommt. Aber auch in Heidelberg hat sich einiges verändert, etwa in der Modebranche. Wenn die Zahlen stimmen, liegt der Handel unter dem Umsatzniveau des Jahres 2019. Von „business as usual“ kann keine Rede sein.
Sind die Probleme, die durch Corona deutlich geworden sind, ein Anzeichen für den Niedergang der Innenstadt, wie wir sie kennen: als eine vom Einzelhandel und Konsum geprägte Mitte der Stadt?
Ich glaube, man kann diese Frage nicht mit „ja“ oder „nein“ beantworten. Der „Niedergang“, von dem Sie sprechen, hat ja eine Geschichte. Wir kennen das Schlagwort der „Krise der Innenstadt“ seit den 1980er Jahren, als die Konkurrenz auf der grünen Wiese immer stärker wurde, als aus einzelnen Fachmärkten Fachmarktzentren entstanden sind, als die großen Möbelhäuser anfingen, auch Güter des täglichen Bedarfs anzubieten, und die Discounter in einem Ausmaß expandierten, wie es in den Zentren schon räumlich nicht möglich gewesen wäre. Wir können noch weiter zurückgehen, in die 1960er Jahre, als die Massenmotorisierung Fahrt aufnahm und sich andeutete, dass immer mehr Menschen aus den Städten in die Vororte, in den Speckgürtel der großen Städte zogen: Mit der Suburbanisierung hat auch der Handel teilweise die Stadt in Richtung Umland verlassen, er ist mitgezogen mit den Einwohnern, raus aus der Stadt.
Die Städte haben damals reagiert: Wenig später sind die ersten Fußgängerzonen entstanden und als Vitalisierung der Innenstädte gefeiert worden.
Aber was viele nicht mehr wissen: Die Fußgängerzone war eine logische Konsequenz des Konzepts der autogerechten Stadt. Die Planungen liefen von Anfang darauf hinaus, die Innenstadt für das Einkaufen möglichst autofrei zu machen, optimal erreichbar für alle, die außerhalb der Stadt wohnten. Die Folge war der Bau von Cityringen, der Bau von Parkhäusern und die Umwandlung der Hauptstraßen und Gassen in Fußgängerzonen. Die suburbane Kundschaft sollte es möglichst bequem haben, wenn sie ins Stadtzentrum kam.
Das war eine politisch gewollte Entwicklung?
Ja, hätte der Markt allein regiert, wäre das nie so gekommen. Es war eine politische Entscheidung: Man wollte, anders als in den USA, die Innenstadt als Handelszentrum erhalten. Die Warenhäuser fungierten als Anker der Innenstädte, es wurde das so genannte Knochenprinzip favorisiert: An beiden Endpunkten der Fußgängerzone sollte ein starkes Warenhaus die Kunden anziehen. Marken wie Karstadt, Hertie, Kaufhof oder Quelle prägten die Innenstädte, die Menschen sind von Pol zu Pol gelaufen, dazwischen waren die eigentümergeführten Läden untergebracht. Durch diese einseitige Optimierung zugunsten des Handels wurde die Innenstadt von anderen städtischen Funktionen weitgehend befreit, vom Wohnen, von Handwerksbetrieben, vom Gewerbe. Das Kalkül war, möglichst viele Menschen durch die Innenstadt zu schleusen, die möglichst schnell konsumierten, um in den Parkhäusern wieder Platz zu machen für die nächsten.
Wie bei einer Mall…
…oder einem Fließband. Aufenthaltsqualitäten spielten keine große Rolle. Es war eine auf Effizienz, auf Rationalisierung und Technisierung getrimmte Konsumkultur…
…die immerhin dazu geführt hat, dass der Handel in der Innenstadt florierte. „In die Stadt gehen“ hieß lange Zeit, einkaufen zu gehen und etwas zu erleben.
Ja, wenn man Auswahl haben wollte, musste man in die Stadt gehen. Und wenn man in einer kleinen Stadt lebte, so wie ich, musste man in die nächst größere Stadt fahren. Die Innenstadt war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts die alternativlose, exklusive Mitte des Einkaufens, der Anziehungspunkt für alle, die mal ein Bad in der Menge nehmen wollten oder wissen wollten, welche Mode gerade angesagt war. Je größer die Stadt, je dichter und zentraler die City, desto höher das Maß an urbanem Lebensgefühl.
Stadt und Handel gehörten zusammen…
…sie waren zwei Seiten einer Medaille. Deshalb der schöne Spruch: „Der Handel braucht die Stadt, die Stadt braucht den Handel“. Beide, Stadt und Handel, haben lange Zeit nach den gleichen ökonomischen Prinzipien getickt. Im späten 19. Jahrhundert flossen die Investitionen der öffentlichen und privaten Hand in die Mitte: Erst kamen die Bahnhöfe und die U- und S-Bahnen, dann die Warenhäuser, die an diese Infrastrukturen andocken konnten. Beim Onlinehandel ist es heute nicht anders: Er dockt an die Investitionen an, die der Staat und die Telekommunikationsunternehmen tätigen.
Der Onlinehandel braucht den Staat, aber er hat die Innenstadt nicht mehr nötig.
Hier kommt zweierlei zusammen: Die Fußgängerzonen sind, zum einen, an ihrem eigenen Erfolg zugrunde gegangen. Denn mit der Verdrängung der inhabergeführten Läden wurden sie immer gleichförmiger. In England spricht man von „Clone Towns“: Wenn es überall in den gleichen Läden das Gleiche gibt, lohnt es sich nicht mehr, in die Stadt zu fahren. Dann sagen sich die Leute: Warum nicht gleich online bestellen? Und das ist der zweite Punkt: Es ist natürlich die Digitalisierung, die unsere Innenstädte seit geraumer Zeit unter Druck setzt.
Was ist da genau passiert?
Der Unternehmer Jeff Bezos hat Amazon 1994 gegründet, wenige Jahre danach kam Google. Wenn ich eine Initialzündung für die Digitalisierung des Einzelhandels nennen sollte, dann war es die Einführung des Smartphones 2007. Es ersetzt das Kaufhaus, es erlaubt den Zugriff auf die gesamte Warenwelt: Der Konsument und die Konsumentin haben durch das Smartphone gleichsam die Innenstadt in der Hand, denn sie sehen, was in den Läden angeboten wird, können vergleichen und prüfen, wie ein Produkt bewertet wird oder wie ein Restaurant im Urteil der Community abschneidet. Kurzum: Das Internet ersetzt alle wesentlichen Funktionen der Innenstadt, das Einkaufen wie die Kommunikation. Der Marktplatz ist sozusagen in die sozialen Netzwerke gewandert. Früher wusste der Händler meines Vertrauens, welche Wünsche und Vorlieben ich habe, heute übernimmt das Internet diese Funktion: „Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, interessieren sich auch für jenes Produkt.“
Nun sehen wir aber in unseren Städten, dass gerade die Digital Natives die analogen Qualitäten des öffentlichen Raums schätzen: Sie treffen sich am liebsten auf einladenden städtischen Plätzen.
Ja, das können wir überall in unseren Städten beobachten: Menschen, die wie selbstverständlich in den digitalen Medien zuhause sind, entdecken die Attraktivität der analogen Welt, werden Bienenzüchter mitten in der Stadt, betreiben unter dem Titel „shared reading“ gemeinsames lautes Lesen oder verabreden sich als „urban sketcher“, mit dem Aquarellkasten bewaffnet, um eine Kirche oder einen Park zu zeichnen. Danach scannen sie die Skizzen ein und teilen sie mit Freunden.
Sie sind Bewohner zweier Welten, der digitalen ebenso wie der analogen.
Der französische Medientheoretiker Paul Virilio hat vom Leben in der „Stereorealität“ gesprochen: Je intensiver wir im virtuellen Raum leben, desto vernehmlicher meldet sich Bedürfnis nach Erlebnissen, die analoge Atmosphären vermitteln. Aber das bedeutet keineswegs eine Flucht aus der digitalen Welt, es handelt sich hier vielmehr um die kompensatorische Wiedergewinnung komplementärer, nicht-digitaler Qualitäten. Ich nenne dieses Phänomen das digitale Biedermeier.
Damit meinen Sie aber nicht das Klischee-Biedermeier: den Rückzug ins Private, das Glück stiller Häuslichkeit, die Spitzweg-Idylle…
Nein, das wäre ein Missverständnis. Das Biedermeier ist die Zeit, in der sich die Industrialisierung auf breiter Front Bahn bricht, in der die Eisenbahninfrastruktur aufgebaut wird, in der so gut wie alle technischen Hochschulen gegründet werden. Und es ist die Zeit, in der die Biedermeiermöbel entstehen, ein neues Design, das erstmals Komfort ins Haus bringt, das Wert auf Bequemlichkeit legt.
Es ist auch die Zeit der Salons, der bürgerlichen Vereinsbildung.
Ja, das ist das Interessante. Wie die Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, weil ihre gewohnte Welt aus den Fugen gerät, zusammenrücken und zugleich ganz neue Möglichkeiten entdecken, zum Beispiel das Reisen mit der Bahn: Die Seebäder und die Voralpenlandschaften werden zu beliebten Urlaubszielen. Am Beispiel der Biedermeier-Epoche können wir modellhaft studieren, wie die technische und soziale Beschleunigung psychisch und geistig verkraftet wird. Heute sind wir durch die digitale Revolution mit einer ähnlichen Herausforderung konfrontiert.
Welche Aufgabe kommt dabei den Innenstädten zu?
Sie müssen das Beste der analogen Welt mit dem Besten der digitalen Welt verbinden. Wir leben nun einmal in der Gründerzeit der Digitalisierung. Und Gründerzeiten sind gekennzeichnet durch zweierlei: Einerseits durch den Wunsch, dass möglichst viel beim Alten bleibt, andererseits durch den Aufbruch zu neuen Ufern, durch die Lust an der Tabula-Rasa. In diesem Spannungsverhältnis müssen wir unsere Innenstädte auf die Zukunft vorbereiten.
Was heißt das konkret für den Handel in der Innenstadt?
Dass alles, was seriell hergestellt werden kann, aus der Innenstadt verschwinden wird. Die Zeit der Standardkonzepte ist vorbei. Stattdessen brauchen wir Dinge, die etwas Besonderes darstellen, die auf die speziellen Bedürfnisse der Kundschaft zugeschnitten sind. Wir sehen heute schon in manchen Kleinstädten, dass es kaum noch Filialisten mit Standardangeboten gibt: Die Stadt Hohenems im Vorarlberg ist umgeben von Fachmarktzentren, aber die Marktstraße, die zentrale Achse der Stadt, ist gesäumt von eigentümergeführten Läden, Mischformen aus Handwerk und Handel, die authentische, atmosphärisch stimmige Qualität bieten, also das, was nicht austauschbar ist, was es nirgendwo sonst gibt. Zum Beispiel ein kleines Modehaus, das individuell angefertigte Kleidungsstücke anbietet und auch über das Netz verkauft.
Wie, bitte schön, stellt man in der Innenstadt authentische baukulturelle Qualitäten her?
Indem man Räume schafft, die eine besondere Geschichte erzählen, im Idealfall die Geschichte der Stadt. In Hohenems ist das nach einem intensiven Dialog mit den Bürgern und mit Hilfe eines engagierten, örtlichen Unternehmers kongenial gelungen: Die historische Bausubstanz ist vorbildlich saniert worden, die Läden für das Erdgeschoss wurden sorgfältig ausgewählt. Das Beispiel Hohenems könnte Schule machen, auch im Maßstab einer Großstadt. Statt der anonymen Immobilienfonds, die in die Innenstädte investieren, brauchen wir wieder mehr Bauherren, die sich wirklich kümmern, die Spuren hinterlassen wollen. Jede Stadt, ob Hohenems oder Köln, muss ein individuelles, auf ihre Geschichte, ihre Gegenwart und ihre Zukunft zugeschnittenes Konzept für die Innenstadt entwickeln. Was nicht ausschließt, dass ein Warenhaus auch in Zukunft funktioniert, wenn es die Bedürfnisse der im digitalen Biedermeier lebenden Gesellschaft erfüllt, nicht zuletzt Bildung: In Siegen beherbergt seit Neuestem Galeria Karstadt Kaufhof das Hörsaalzentrum der Universität.
Wir sollten die Innenstadt als Stadtmitte behalten?
Ja, schon deshalb, weil es keinen anderen Ort gibt, wo unsere heterogene, auseinanderstrebende Gesellschaft so beiläufig zusammenkommt. Aber: Es geht nicht in erster Linie um die Zukunft des Einzelhandels oder der Fußgängerzone. Wer aus diesem verengten Winkel Stadtentwicklung betreibt, macht einen fundamentalen Fehler. Es geht um die Innenstadt als Ganzes. Wofür brauchen wir sie? Was suchen wir da eigentlich? Was finden wir in der Mitte der Stadt, was es sonst nirgendwo gibt? Wie müssen Räume in der Innenstadt aussehen, in denen wieder gewohnt und gearbeitet wird? In denen vielleicht wechselnde Nutzungen möglich sind? Das sind Fragen, die wir vorm Hintergrund der Digitalisierung Schritt für Schritt klären müssen, in Form eines städtischen Leitbildes oder eines konkreten Masterplans.
Wer ist wir?
Die Bürgermeister, die Stadtplaner, die Architekten, die Gemeindevertreter, die Zivilgesellschaft – alle, die Räume planen und dafür Verantwortung übernehmen. Was wir in der Vergangenheit aus der Sanierung der Altstädte und der Gründerzeitquartiere, auch aus dem Umbau der Großsiedlungen in West- und Ostdeutschland gelernt haben, muss eingebracht werden in den Umbau der Innenstädte. Vor allem die holistische, ganzheitliche Perspektive: Wohnen, Landschaft, Mobilität, Verkehr, soziale Infrastruktur müssen zusammen gedacht werden, ohne einseitige Fixierung auf den Handel. Dann kommt man, nach einer ungeschminkten Bestandsaufnahme, womöglich zu dem Ergebnis: Okay, wir haben jetzt zwanzig Prozent Leerstand, aber wir wissen, wo wir hinwollen, wir wissen, was wir in den nächsten fünf Jahren machen müssen.
Und was blüht Städten, die das nicht tun?
Die werden zu den Verlierern dieser Transformation gehören. Aus der Fußgängerzone wird, wenn das noch möglich ist, vielleicht eine ganz normale Straße. Aus den Erdgeschossen werden, falls Nachfrage da sein sollte, vielleicht Wohnungen, und die Innenstadt hat vielleicht noch das eine oder andere historische Gebäude, vielleicht auch noch hier und da ein Restaurant. Aber Urbanität im klassischen Sinn wird es dort nicht mehr geben.
Es würde das eintreten, was man aus den Dörfern kennt, der Bagel-Effekt: In der Mitte leer, an den Rändern voll.
Genau, die Städte verlieren dann ihre dichte Mitte, es wird zunehmend Brachen geben. Deutschland ist ja eine Nation der kleinen Städte: Die eine wird den Umbau hinkriegen, die andere nicht. Dann werden die Leute sich eben neue Mitten suchen und in die Nachbarstadt fahren, wenn sie bummeln wollen. Oder sie entdecken Suburbia als Ersatz: Fachmarktzentren werden hybrid, nehmen Stadt-Center-Charakter an und bieten großflächiges Entertainment. Wenn man das gut macht, kann auch auf der grünen Wiese eine urbane Quasi-Mitte entstehen.
Aber hängen die Menschen nicht immer noch an „ihrer“ Innenstadt?
Naja, es hat sich noch keiner an der Innenstadt angekettet. Schauen Sie sich doch die neue Ausweichphilharmonie in München an, ein großartiges Provisorium in einem Gewerbegebiet am Stadtrand, nebenan ist ein Reifenhändler. Unsere Städte werden heute nicht mehr allein über die Flächennutzung definiert, sondern im Wesentlichen dadurch, dass Menschen in den Städten irgendwo irgendwas unternehmen: Ob ich online einkaufe, einen Film screene oder ein Buch schreibe – es ist doch völlig egal, wo ich das mache. Schon deshalb ist der Begriff der Zentralität, was die Entwicklung der Innenstädte und des Handels angeht, völlig absurd. Der Handel kann doch gar nicht mehr nachvollziehen, wo Kaufentscheidungen getroffen werden.
Trotzdem gilt die City immer noch als das Herz der Stadt. Man zeigt Besuchern nicht den Stadtrand, sondern die Mitte. Wie kommt man in Zukunft dorthin?
Einstweilen mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Man könnte die Innenstadt auch komplett autofrei machen, nach dem Vorbild der Fußgängerzone.
Das halte ich für außerordentlich risikoreich.
Warum?
Weil es für Menschen, die im Umland wohnen, bis heute kein öffentliches Verkehrsangebot gibt, das konkurrenzfähig wäre, abgesehen von Ausnahmen wie Berlin, Hamburg und natürlich München.
Innerhalb der Stadtgrenzen böte sich das Fahrrad an.
Schon, aber genauso, wie ich es für einen Fehler halte, die Innenstadtentwicklung eindimensional unter der Perspektive des Handels zu betrachten, warne ich davor, die Verkehrsfrage in den Vordergrund zu stellen. Dann würden wir auf fatale Weise die Fehler von gestern wiederholen, nur unter anderen Vorzeichen: Statt der autogerechten Stadt soll es nun die fahrradgerechte Stadt sein. Ich bin gern bereit, über Fahrrad- und Straßenbahnfahren, Carsharing und E-Scooter zu diskutieren. Aber noch einmal: Entscheidend ist, dass wir eine langfristige Vorstellung von der Innenstadt gewinnen. Dass wir uns darüber verständigen, wozu sie in Zukunft dienen soll. Als Muster für alles Gute, für die autofreie Innenstadt, für Wohnen und Cityerschließung durch den Öffentlichen Personennahverkehr, wird immer wieder Kopenhagen genannt. Aber Kopenhagen hat die Planungen für die Ringbahn mit selbstfahrenden Zügen, die alle Stadtteile, auch Suburbia einbeziehen, vor mehr als zwanzig Jahren in Angriff genommen.
Wir sind in Deutschland zu spät dran?
Wir haben es versäumt, für die nötige Infrastruktur zu sorgen. Die Regionaltangente West, das Projekt einer Straßenbahnverbindung vom Taunus über den Frankfurter Flughafen bis nach Neu-Isenburg, das ich schon vor mehr als dreißig Jahren als Lehrbeauftragter an der TH Darmstadt mit städtebaulichen Entwürfen begleitet habe, gibt es bis heute nicht. Wenn wir nun den Innenstadthandel auf Mobilitätskonzepten aufbauen, die erst in zehn Jahren greifen, dann muss man kein Planer sein, um sich vorzustellen, dass das niemandem mehr hilft. Das ist so, als würde man einem Ertrinkenden sagen: Ich komme in zehn Jahren wieder und werfe dir dann den Ring zu.
Das Interview führte Christopher Schwarz

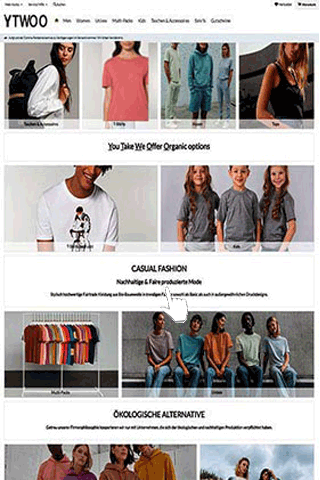



Hinterlasse jetzt einen Kommentar