Im zweiten Teil des großen Interviews über Bauen und Umwelt spricht Harald Simons über das Wohnen auf dem Lande und die neue Liebe zum Einfamilienhaus. Der Immobilien-Weise plädiert für deutlich höhere Grundsteuern, sieht aber zum Privatbesitz an Grund und Boden keine Alternative.

Herr Professor Simons, das Einfamilienhaus ist in den vergangenen Monaten ins Gerede gekommen. Wegen des Flächenverbrauchs. Es gibt seit Jahrzehnten das politische Ziel, den täglichen Zubau von Landschaft auf 30 Hektar zu beschränken. Wir verbrauchen in Deutschland aber doppelt so viel Fläche.
Um die Jahrtausendwende gab es diese Diskussion um Leerstand und Rückbau. Da hieß es, Deutschland ist im Prinzip gebaut. Wir hatten in den Großstädten rückläufige Einwohnerzahlen. Und dann drehte sich das innerhalb von wenigen Jahren. Plötzlich wollten alle in die Städte. In die großen Sieben wie Berlin, München oder Köln, aber auch in die schnuckeligen, mittelgroßen Städte wie Heidelberg oder Münster. Das Ergebnis waren steigende Mieten und Diskussionen um Enteignung oder Mietendeckel. Gleichzeitig blutete das platte Land aus, nicht nur im Osten. Da gab es Dörfer mit zwanzigmal mehr Menschen, die älter als 60 Jahre waren als Kinder und Jugendliche unter Zwanzig. Da bricht nicht nur ein Wohnungsmarkt zusammen, sondern eine ganze Kultur.
Das hat sich aber gehörig geändert.
Seit drei oder vier Jahren haben wir eine Trendänderung. Jetzt gibt es die Umzüge von den Schwarmstädten auf das Land. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Zuwanderung zum Beispiel von Köln in die Vulkaneifel. Oder von Berlin in die Uckermark Von Hamburg nach Lüchow-Dannenberg. Gott sei Dank! Denn damit entlasten Sie nicht nur die Wohnungsmärkte der Topstädte. Die Zugezogenen stabilisieren auch die ländlichen Regionen. Was aber wollen die Umzügler da? Sie wollen nicht aufs Geschoss ziehen. Sie wollen ins Einfamilienhaus. Und in diese Situation stößt nun die Diskussion eines gewissen städtischen Milieus um das Einfamilienhaus. Aber die Politik sollte eins nicht vergessen: Das typische Einfamilienhaus-Gebiet nennt sich Dorf. Und eine kulturelle Abwertung oder Belegung mit besonders hohen Steuern oder Abgaben, Sanierungsgeboten oder was auch immer vergrößert den Stadt-Land-Unterschied, den wir ohnehin in Deutschland haben. Das halte ich für hochgradig gefährlich. Denn dieses Gefühl des Abgehängt-Seins der Landbevölkerung hat sich dort bereits kulturell niedergeschlagen.
In Frankreich hat das zur Bewegung der Gelbwesten geführt.
Ich komme viel auf dem Land herum. Und ich beobachte, dass man sich dort von den Prenzlauer-Berg-Eliten herum gestoßen fühlt. Da ich als politiknah wahrgenommen werde, höre ich oft die Frage: „Was habt ihr euch denn da ausgedacht?“ Die Themen, die die Menschen dort bewegen, sind meilenweit entfernt von denen des Feuilletons. Viele haben sich vom herrschenden politischen Diskurs abgewandt. Wenn wir jetzt hingehen und diese Lebensform diskreditieren und signalisieren, dass man sich schämen muss, wenn man im Einfamilienhaus wohnt und Nackensteaks auf dem Grill brutzelt, dann ist das für den Zusammenhalt des Landes eine Katastrophe.
Wie kommt es zu dem Country-Trend?
Haupttreiber sind die Preise. Nehmen wir das Beispiel einer Familie mit einem Kind. Ein zweites ist geplant. Man lebt in Berlin-Kreuzberg in einer Zweizimmerwohnung. Das wird jetzt zu eng. Was sind die Optionen für diese Familie? Eine Fünfzimmerwohnung in einem vergleichbaren Viertel ist zu teuer und nicht zu finden. Die können nach Reinickendorf gehen. Oder in eine der Reihenhaussiedlungen vor der Stadt – langes Pendeln garantiert. Oder aber, sie entscheiden sich für eine radikale Lösung und ziehen aufs Land ins Einfamilienhaus. Eventuell muss einer der Partner den Arbeitgeber wechseln. Aber das ist beim aktuellen Arbeitsmarkt machbar. Und heute, nach Corona, kommt hinzu, dass selbst Volkswirte oder Journalisten an mehreren Tagen in der Woche im Home-Office arbeiten können. Für die Familie wird mit dieser Entscheidung vieles besser. Es gibt da draußen KITA-Plätze, die Schulen funktionieren. Es gibt den großen Garten für die Kinder. Und es gibt im Haus Platz für das Heimbüro.
Nicht zuletzt profitiert auch das Land von solchen Familien.
Ja, die geben Geld am Ort aus, sind eine kulturelle Bereicherung und machen vielleicht sogar bei der örtlichen Feuerwehr mit. Den Städten dagegen tut es nicht weh, wenn ein paar sozial-starke Familien wegziehen. Aber wenn hundert solcher Familien sich in der Uckermark ansiedeln, wirkt sich das aus.
Ökologisch ist diese Stadtflucht aber umstritten. Nötig ist sie auch nicht. Wenn man beispielsweise durch Berlin fährt, sieht man überall ungenutzte Flächen, die nur auf die Erschließung warten. Warum gibt es in Städten wie Berlin trotz dieser freien Flächen diese Preissteigerungen?
Es gibt mehrere Gründe. Zum ersten ist da der politische Widerwille. Typisch war das Vorgehen bei der Planung des ehemaligen Tempelhofer Flughafens. Da haben Initiativen selbst eine maßvolle Bebauung verhindert. Sobald sich eine Industriebrache auftut, heißt es: “Nicht bebauen! Park, Kaltluftschneise!” Im Gleisdreieck wurde vor allem ein Park angelegt. Ist ja schön, aber wo Parks sind, gibt es keine Wohnungen. Erst recht gibt es keine Diskussion über die Schrebergärten in Kreuzberg oder anderen innerstädtischen Bezirken.
Weil sich kein Politiker die Finger verbrennen will.
Das Zweite sind die viel zu niedrigen Kosten für das Halten von Boden. In den USA, Japan oder Großbritannien trägt Bodensteuer bis zu 14 Prozent zum Gesamtsteueraufkommen bei. Da ist es normal, dass ältere Paare ihr großes Haus verkaufen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Sie ziehen in ein kleineres Haus, weil die Steuer so richtig weh tut. Hierzulande ist die Grundsteuer fast eine Bagatellsteuer. Die Briten oder die Amerikaner holen da richtig viel Geld raus. Das ist sozial auch völlig ok. Das ist eine wunderbare indirekte Umverteilungsmaßnahme. Die Leute in den Villengegenden zahlen viel. Die Leute in den fünfstöckigen Mietskasernen zahlen wenig. Das hätte auch in Deutschland viele Vorteile, ist aber politisch völlig utopisch. Mit einer höheren Grundsteuer, die am Knappheitsgrad des Bodens ausgerichtet ist, würde die Politik die intensive Nutzung des Bodens fördern.
Der marktlibertäre Ökonom Milton Friedman bezeichnete die Grundsteuer als „die am wenigsten schlechte“ Steuer. Aber kann man mit dieser Steuer das 30-Hektar-Ziel erreichen?
Dieses Ziel ist Unsinn. Es schert alle Regionen über einen Kamm. Da wollte man zum Beispiel analog zum Emissionshandel einen Flächenhandel einrichten. Was hätte das für eine Wirkung? Es würde nur noch im Münchner Umland und vergleichbaren Gegenden gebaut. Das ergibt da einen Sinn, wo man um jede Streuobstwiese kämpfen muss. Aber in der Uckermark könnten Sie dann nicht mehr bauen. Mit der Begründung, man wolle Flächen sparen. Ich wohne die Hälfte der Zeit in der Uckermark. Im Umkreis von zehn Kilometern wohnen dort weniger als zweitausend Leute. Bringen Sie dort einmal einem alteingesessenen Grundstückseigentümer bei, dass seine Tochter auf seinem Grund kein Einfamilienhaus bauen darf. Das ist eine Verengung der Perspektive auf die Probleme der Städte – wahrscheinlich, weil 90 Prozent der Journalisten dort wohnen.
Entschiedener Einspruch: Diese Art der Zersiedlung der offenen Landschaft ist doch ein Trauerspiel. Sehen Sie sich das zum Beispiel im total zersiedelten Bergischen Land an. Da sind aus reizenden Fachwerksweilern öde Vorstadtsiedlungen mit Bürgersteigen und Peitschenlampen geworden. Die könnten irgendwo am Rande von Köln oder im Ruhrgebiet sein. Die Verbindungsstraßen sind stets voller Verkehr, weil jede Aktivität mit dem Auto erledigt werden muss. Die Eltern fungieren als Taxifahrer und fahren ihre Kinder mal zur Reit-, mal zur Flötenstunde. Und wenn die Kinder fünfzehn sind, wollen sie zurück in die Stadt. Das kann doch kein politisches Ziel sein.
Da haben Sie Recht. Die Zersiedlung ist eine Seuche. Deswegen ist das eine Frage von Maß und Grad. Das hat aber auch mit der Art und Weise zu tun wie Kommunalpolitiker Bauland ausweisen, mit dem Ziel, Familien aus den Nachbargemeinden in die eigene Kommune zu locken. Aber das Kernproblem ist ein anderes. Denn im Grunde gibt es hinreichend Flächen in den Dorfkernen. Jedoch kommen wir da nicht heran.
Warum nicht?
Der Raumplaner Karl Ziegler von der Technischen Universität Kaiserslautern hat dazu ein Projekt gemacht. Es untersuchte eine kleine ländliche Gemeinde mit 1500 Einwohnern. Es standen insgesamt Flächen für 120 Einfamilienhäuser im Innenbereich zur Verfügung. Aber keine dieser Flächen stand tatsächlich zur Verfügung, da die Eigentümer verkaufsunwillig waren. Da kommen dann Argumente wie: Meine Enkelin will vielleicht mal hier bauen. Ein anderer hatte Pferde dort stehen. Und wieder andere rechneten sich aus, dass sie nur 30 000 Euro, die sie nicht wirklich brauchten, durch den Landverkauf erlösen würden.
Das bestätigt die These, nach der das Halten von Boden zu billig sei.
Eben. Es gibt keinen Veränderungsdruck. Wenn Sie durch die Dörfer gehen, sehen Sie immer wieder Leerstand, gerade in den Dorfkernen. Ein Teil erklärt sich dadurch, dass es sich um verbaute Häuser handelt ohne PKW-Stellplatz, ohne Garten. Die will keiner mehr. Im Grunde musste man hier eine Art Flurbereinigung vornehmen. Wenn die Eigentümer zweitausend Euro Grundsteuern im Jahr zahlen müssten, dann wären die ganz fix mit dem Verkaufen. Das Problem würde sich von allein regeln. Aber wie wollen Sie angesichts des Leerstandes auf dem Land jungen Familien verbieten, im Einfamilienhaus zu wohnen.
Kommen wir zu einem anderen Thema: Marktliberale wie der Ökonom und ehemalige Chef der britischen Finanzaufsichtsbehörde Adair Turner oder Klassiker wie Adam Smith haben und hatten ihre Zweifel, inwieweit Boden mit anderen marktfähigen Gütern vergleichbar ist. Er ist schließlich nicht beliebig vermehrbar wie Schrauben oder Schweine. Passt das Privateigentum an Grund und Boden zu unserer marktwirtschaftlichen Ordnung?
Ich kenne das Argument. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Sie das in der marktliberalen Tradition verorten. Ich kenne das nur aus der sozialistischen Ecke.
Nun ja, jeder Grundbesitzer ist, genau genommen, ein Monopolist. Weil sein Grundstück einzigartig ist und nur von ihm angeboten werden kann. Marktliberale haben mit Monopolisten so ihre Probleme.
Gut, das ist die alte Bodenrente-Debatte. Die Bodenrente ist natürlich leistungsfeindlich. Der Adel lebte früher von der Bodenrente. Das war schlicht leistungsfeindlich. Und das war und ist großer Mist. Insofern sehe ich grundsätzlich das Argument ein. Nur: Was können Sie dagegen machen? Wir können nicht sagen, der Boden gehört niemanden. Wir könnten höchstens sagen: Wir übertragen es dem Staat. In beiden Fällen hätte der Boden keinen kalkulierbaren Preis. Wenn er aber keinen Preis hat, investiert auch keiner in Boden und seine Erschließung. Nicht in Abriss, nicht in Dekontaminierung. Erinnern Sie sich an die Baukultur der DDR? Dort wurde immer gebaut, wo es gerade billig war. Und billig war es dort, wo es grün war. Da kann man groß planen. Ohne viel geistigen und sonstigen Aufwand. In Baulücken hineinzubauen, ist teuer. Und das lohnt sich nicht, wenn der Boden einen Wert von Null hat. Wenn Sie den aber für tausend Euro pro Quadratmeter in Berlin Mitte verkaufen können, dann zupfen Sie jeden Grashalm raus.
Staatseigentum an Boden führt folglich zur Zersiedlung?
Ja. Denn Boden ist zwar nicht vermehrbar, aber verminderbar. Wenn Sie Moskau und Paris vergleichen, dann stellen Sie fest, dass Paris deutlich dichter besiedelt ist. In Mokau lösen sich Brachringe um die Stadt mit hochverdichteten Plattenbau-Siedlungen ab. Im Realsozialismus ging alles Bauen ins Greenfield. Und so gut wie nie ins Brownfield, weil die Erschließung ehemals genutzter Grundstücke teuer ist. Das Ergebnis ist: Sie haben eine viel zu große Stadt. Sie haben eine gigantische Zersiedlung. Über eine Stunde Anfahrtszeit – wohin immer auch – ist in Moskau etwas völlig normales. Die Hälfte der Zeit fahren Sie durch Brownfields, durch Pröll, durch ein ungenutztes Nichts. Was für eine Lebenszeitverschwendung!
Und was fällt Ihnen zum Monopolisten-Argument ein?
Die Auswirkungen werden durch das staatliche Handeln noch verstärkt. Wenn irgendwo Bauland ausgewiesen wird, dann passiert das, vor allem in Verdichtungsgebieten, mit Verweis auf das 30-Hektar-Ziel in kleinsten Dosen. So unter dem Motto: Ein paar Hektar Bauland ausweisen müssen wir nun mal, aber nur wenn präzise nachgewiesen wurden, wofür. Also, wenn 27 Einfamilienhäuser geplant sind oder 126 Wohnungen, dann wird auch nur ein Baufeld und kein Quentchen mehr erschlossen. Der ausgewiesene Baugrund gehört dann einem Bauern. Und der hat dann keine Konkurrenz und ist Monopolist.
Was können die Verwaltungen tun?
Konkurrenz schaffen. Sie können zwei Baufelder ausweisen. Dann ist das Monopol zerstört.
Aber das führt wieder zu mehr Zersiedlung.
Nun, einen Tod müssen Sie halt sterben!

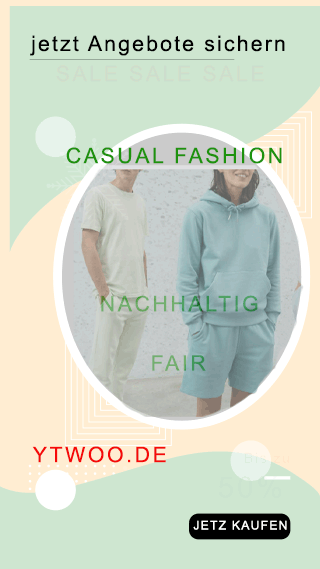



Hinterlasse jetzt einen Kommentar