Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, kommen immer häufiger negative Strompreise zustande. Im Atomland Frankreich führt das zu massiven Problemen.

(Günther Redenius/Pixelio.de)
Atomstrom und Erneuerbare ergänzen sich. So lautet eine Erzählung der Kernkraftbefürworter. Das Gegenteil ist wahr. Denn Atomkraftwerke sind unflexibel. Die Betreiber können sie nicht – wie etwa Wasserkraft- oder Gaskraftwerke – relativ schnell hoch – oder herunter fahren. Diese Erfahrung machte in den vergangenen Wochen unser Nachbarland. Dank des sonnigen und windreichen Wetters lieferten die Erneuerbaren jede Menge Strom – zusätzlich zu der trägen atomaren Grundlastversorgung. Ergebnis: Das Überangebot sorgte für negative Strompreise, vor allem an Samstagen und Sonntagen.
Am vorvergangenen Wochenende sah sich Frankreichs Monopolversorger EDF deshalb gezwungen, gleich sechs AKW stillzulegen. Anders als gewöhnliche Güter wie Kohlen, Öl oder Sardinendosen lässt sich Strom nicht ohne weiteres lagern. Um zuviel Strom im Netz zu vermeiden, setzen Versorger und Betreiber Anreize zum kontrazyklischen Verbrauch. Oder sie müssen Stromquellen abschalten.
Denn der Bau von Stromspeichern steckt erst in den Änfängen. Stationäre Großakkus sind (noch) kostspielig. Auch Speicherkraftwerke, bei denen Wasser während der stromreichen Zeiten in hochgelegene Bassins gepumpt wird, um in stromknappen Zeiten Turbinen anzutreiben, sind teuer. Und die Lastverschiebung durch intelligente Netze steht erst in den Anfängen.
Träge AKW – negative Strompreise
Die Krux für unser Nachbarland: Gleich drei Ursachen machen Atomkraftwerke unflexibel. Punkt eins: AKW sind zwar billig im Betrieb. Der Kostenanteil für die Brennstäbe beträgt pro erzeugter Kilowattstunde Strom nur zwei Cent. Umso teurer sind aber Bau und Entsorgung. Wegen der hohen Fixkosten müssen AKW möglichst viele Stunden mit möglichst hoher Leistung gefahren werden.
Die jüngsten AKW-Projekte kosteten ein Vielfaches der unspünglich geplanten Summe. Die Projektierung und Errichtung des seit 2007 im Bau befindlichen Reaktors im normannischen Flamanville wird bis zum erwarteten Anfahren im kommenden Jahr 19,1 Milliarden Euro gekostet haben. Geplant waren 3,3 Milliarden Euro. Die Gestehungskosten pro Kilowattstunde Strom aus Flamanville werden, einer Berechnung des französischen Rechnungshofes zufolge, elf bis zwölf Cent kosten. Für die neuen Blöcke im englischen AKW Hinkley Point hat die britische Regierung einen Preis von rund elf Cent pro Kilowattstunde garantiert. Zum Vergleich: Sonnenstrom gibt es selbst im bewölkten Deutschland ab vier Cent. Windstrom ist ähnlich günstig.
Modulation ist möglich, aber kompliziert
Punkt zwei: Jede Veränderung der Auslastung strapaziert das Material. Wegen des Druck- und Temperaturwechsels kommt zu Ermüdungserscheinungen – manchmal bis zum Bruch von Schweißnähten. Das Risiko einer Kernkatastrophe steigt. Die Zahl der zulässigen Lastwechsel ist deshalb begrenzt.
Punkt drei: Das Hoch- und Herunterfahren der Blöcke ist ein technisch komplexer Prozess. Atomare Prozesse laufen in der Natur über Jahrtausende. Jeder Eingriff ist mit einem Risiko behaftet. Viele Steuergrössen müssen dazu ultrapräzise eingestellt sein. Nur dann lässt sich die Kettenreaktion lenken. Zum Beispiel muss das Spaltmaterial exakt positioniert sein. Auch die chemische Struktur des Wassers im Reaktor muss genau stimmen. Gleiches gilt für die Druck- und Wärmeverhältnisse.
Das sogenannte Modulieren geschieht zwar regelmäßig – allerdings nur begrenzt. Es gibt Kraftwerke, die ihre Leistung bis zu fünfmal im Jahr für maximal sechs Stunden um 25 Prozent vermindern. Andere können innerhalb von 18 Monaten bis zu 30 Mal ihre Leistung für maximal 72 Stunden um die Hälfte einschränken. Dafür müssen die Techniker und Ingenieure aber aufwendige Vorbereitungen mindestens 24 Stunden vorher in Gang setzen. Flexibilität sieht anders aus. Atomare und nachhaltige Energieversorgung passen einfach nicht zueinander.
Viele Ausfälle
Heikel: Ein Umdenken auf breiter Basis findet in unserem Nachbarland nicht statt. Im Gegenteil, Präsident Emmanuel Macron will die Atomkraft noch ausbauen – trotz des Ärgers mit dem Reaktorneubau in Flamanville. Trotz der Ausfälle in den vergangenen Jahren. Nur die Importe aus Deutschland und anderen Nachbarstaaten verhinderten seinerzeit den Zusammenbruch des französischen Netzes. Marode Schweißstellen und Kühlwassermangel hatten die Abschaltung fast der Hälfte der Blöcke erzwungen.
Rechtspopulisten wollen noch mehr Atom
Da der Atompark Frankreichs nicht jünger wird und heiße Sommer mit ausgetrockenten Flüssen sich wiederholen, wird es auch in den kommenden Jahren zu weiteren Ausfällen kommen. Doch trotz der Schwierigkeiten steht die Bevölkerung hinter der Atompolitik. In einer Umfrage lehnten nur 25 Prozent der Befragten die Kernkraft ab. Für viele Franzosen ist Atomkraft die französische Energie schlechthin. Der Chef des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella hat sich dazu klar geäußert: „Atomkraft ist ein französisches Kapital“. Das RN hat sogar angekündigt, die Zahl der Windräder zu reduzieren.
Mehr: Cleanthinking; L’info durable.

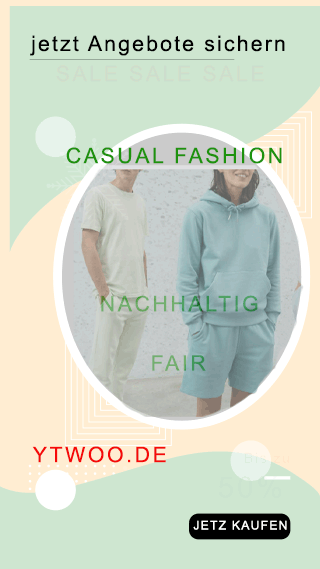



Hinterlasse jetzt einen Kommentar